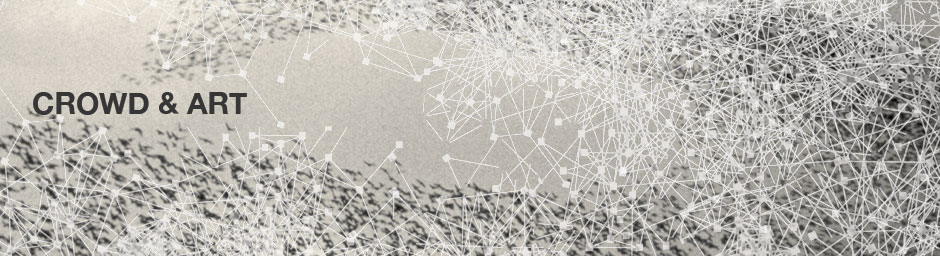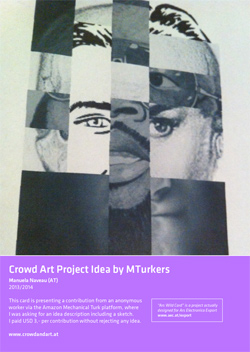Der österreichische Philosoph Robert Pfaller hat im Jahr 2008 sein Buch Ästhetik der Interpassivität veröffentlicht und darin einen Aufsatz mit dem Titel Against Participation vorgestellt, der sehr früh sehr kritisch hinterfragt, was Beteiligung abseits einer romantisierenden Haltung zu Partizipation und einhergehenden Hoffnungen und Wünschen zu Demokratisierung, Emanzipation oder Ermächtigung bedeuten kann. Imzuge meiner Auseinandersetzung mit Crowd Art, also künstlerischer Modelle der Beteiligung über Computertechnologie und Internet, wollte ich seine aktuelle Sicht auf Formen wissentlicher oder nicht wissentlicher, freiwilliger oder unfreiwilliger Beteiligung ins Gespräch bringen.
Gespräch mit dem Philosophen Robert Pfaller
am 11.05.2014 im Kleinen Café im 1. Bezirk in Wien
Manuela Naveau: Wenn es um Partizipation in der Kunst geht, konnte ich feststellen, dass die Medienkunst in den kunsttheoretischen Aufarbeitungen zu dem Thema eigentlich sehr oft ausgeblendet wurde. Auch wenn Duchamps Briefe an seine Schwester aus dem Jahr 1919 als frühe Arbeit sogenannter partizipatorischer Kunst gilt (vgl. Wege 2002), so haben es die Telefonbilder von László Moholy-Nagy aus dem Jahr 1922 interessanter Weise nicht so leicht. Denn bei Partizipation schwingt immer noch so etwas Romantisches mit: da macht man etwas gemeinsam mit anderen und das ist schön! Wenn man sich jedoch ansieht, welche Prozesse von Künstler/innen über das Internet geöffnet werden, so werden wieder Formen der Beteiligung verstärkt ins Blickfeld gerückt, die nicht ausschließlich auf gemeinsames Schaffen von Angesicht zu Angesicht ausgerichtet sind. Da stolpert man dann auch über Formen unbewusster Beteiligung, Formen von Aneignung und Formen der Beteiligung vieler Anderer, die man nicht kennt und auch nicht sieht. Und man tut sich mit dem Begriff der Partizipation auf einmal sehr schwer. Man begegnet über das Medium Internet auf einmal einer Vielzahl von Personen, einer Masse, einer Crowd und Crowd Art wurde als Terminus eingeführt. Aber es geht dabei nicht doch um Formen von partizipativer Kunst? Wie siehst du das?
Robert Pfaller: Ich finde ja immer interessant, wie Begriffe verschwinden, oder wie die Vorgeschichte eines Begriffs ausschaut. Man muss sich zum Beispiel fragen: anstelle welchen anderen Begriffs taucht er auf? Das finde ich bei Begriffen wie ‘Partizipation’ und ‘Interaktion’ auffällig, auch bei ‘Masse’ und ‘Crowd’ und ähnlichen Begriffen muss man sich das im Detail mal ansehen.
MN [hier und in der Folge]: Kann man sagen, dass der deutsche Begriff ‚Masse‘ viel erklärungsbedürftiger ist als der englische Begrifft der ‚Crowd‘, weil er nicht diese geschichtliche Aufladungen von Le Bon, Freud und so weiter trägt und daher viel unproblematischer in der Verwendung ist?
RP [hier und in der Folge]: Ja, wobei, da muss man auch vorsichtig sein. Nicht jede spontane Zusammenrottung von Individuen ist gut. ‘Multitude‘, das ist zum Beispiel in dem Buch „Empire“ von Negri und Hardt ein – meiner Meinung nach – sehr problematischer Begriff. Schwierige Fragen politischer Organisation, wie: ‘Wieviel Steuerung brauchen große Gruppen?’, ‘Wie muss ich das hierarchisieren?’ usw., werden hier ausgeblendet durch einen vermeintlich unproblematischen, scheinbar völlig unpolitisch besetzen Begriff – ähnlich wie bei ‘Crowd’ oder ‘Community’. Und den Begriff ‘Multitude’ haben sie von Spinoza, der ihn jedoch ganz kritisch verwendet, um gerade die reaktionärsten Massen damit zu bezeichnen. Spinoza sagt: die Massen treten zunächst offenbar regelmäßig als reaktionäre Massen in Erscheinung, als Mobs; und bisweilen lynchen sie ihre demokratisch gewählten Vertreter. Im Vergleich zu diesem Problembewusstsein Spinozas ist bei Hardt und Negri ein befremdlicher Kritikverlust zu beobachten – noch dazu in einer durchaus politisch ambitionierten Theorie. Auch wenn man heute von ‘Crowds’ spricht, sollte man zuerst vielleicht mal an Lynchmobs denken – oder zum Beispiel auch an so fragwürdige Akteure wie Shitstormer. Dann hat man das schwärzeste Bild vor Augen und weiß ungefähr, um welche Probleme und Gefahren es bei der Sache geht.
MN: Siehst Du einen Unterschied in den Begriffen Masse und Crowd? Ich selbst beobachtete, dass der Begriff der Masse vielmehr diese Einheit zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort ist und Crowd eher das Bestehen aus einzelnen Individuen beschreiben könnte, die zeit- und ortsunabhängig agieren. Also eine Art Ansammlung von Personen, die nicht unbedingt ein Ding im Hier und Jetzt gemeinsam machen wollen. Ich denke da zum Beispiel an die Projekte The Sheep Market oder The Johnny Cash Project von Aaron Koblin. Der Künstler initiiert Prozesse der Beteiligung: 10.000 Personen zeichnen Schafe über Amazon Mechanical Turk und werden dafür bezahlt. Anders beim Johnny Cash Project, bei dem mehrere Tausend ein Videoframe nachzeichnen und so zwar einen Beitrag als Teil der Johnny Cash Community leisten. Dies passiert jedoch alles nicht unbedingt zu einem bestimmten Zeitpunkt und die Intentionen der Beteiligten sind auch ganz unterschiedlich.
RP: Also der größte Unterschied zu Masse ist dann der, dass in der Masse die Individuen einander als anwesend begegnen. Während sie in diesen Crowd-Situationen nur sternförmig über ein Zentrum miteinander verbunden sind. Die wissen gar nicht, ob sie nicht vielleicht der einzige sind, der ein Schaf zeichnet für dich oder aber einer unter tausenden Schafzeichnern. Das ist glaube ich der größte Unterschied: die Struktur. Eine Masse jedoch kann mit einem relativ abwesenden Führer leben. Der kann schon gestorben sein, aber die glauben noch an den und sind vereint. Die müssen miteinander verbunden sein, einen Platz besetzen, sich als tausendfach anwesend erleben. Die horizontalen Beziehungen sind vorhanden und viel stärker ausgeprägt als in deinen Crowd-Beispielen.
MN: Und wie denkst du über die Auslagerungspraktiken der Künstler/innen, die sich über das Internet ergeben? Dass Aaron Koblin also eine Crowdsourcing Plattform wie Amazon Mechanical Turk im Jahr 2006 nutzt, um seine künstlerischen Projekte zu machen, war eine ganz neue Möglichkeit. Ich meine, dass Künstler/innen ihre Arbeiten durch andere anfertigen lassen, ist ja grundsätzlich nichts Neues. Interessant dabei ist jedoch, dass neue Angebote entstehen, um mit ‚den Anderen‘ zusammenzuarbeiten. Personen, die man wahrscheinlich in einem Leben vor dem Internet nicht so leicht bis gar nie getroffen hätte.
RP: Wenn man untersucht, was da passiert, ist es wahrscheinlich am nüchternsten, man hält sich an die Modelle ökonomischer Ausbeutung. Was passiert, wenn Prada in China die Kleider nähen lässt, oder Adidas die Schuhe? Das passiert ja nicht nur zwischen Europa und China, sondern es passiert zum Beispiel auch innerhalb Indiens. Es gibt hochbezahlte Stardesigner in Indien, die seit zehn Jahren plötzlich auf die Idee gekommen sind, indische Nationalmode zu machen. Indien hat eine neue Folklorisierung erfahren. Vorher hatten sie sich an dem Westen ausgerichtet, aber jetzt sagen sie: „Wir sind eigentlich die intellektuelle Supermacht! Bei uns entstehen die Computerprogramme, und deswegen wollen wir das in der Elite-Mode zeigen.“ Und jetzt beschäftigen die indischen Top-Designer ganz schlecht bezahlte Handwerkerinnen auf dem Land, die holzdrucken und sticken und ganz wenig Geld bekommen für diese Stickereien, die aber ganz teure Mode verzieren. Mode, die nicht mehr nur in Indien, sondern mittlerweile auch im arabischen Raum boomt. Da entsteht gerade ein eigener Modekosmos, wie die Anthropologin Tereza Kuldova in einem neuen Buch beschreibt.
Ich glaube, diese Vorgänge muss man nüchtern vergleichen. Es gibt sicherlich so etwas wie eine Kreativität der Massen; es gibt auch eine hochentwickelte, traditionelle, weitgehend anonyme Handwerkskunst. Das Auffällige ist aber oft, dass es in der Wertschöpfung ein extremes Gefälle gibt, zwischen denen, die etwas herstellen und denen, die es in irgendeinen relevanten Markt einschleusen. Wenn man gute Kunst darüber machen will, ist es wichtig, dass man sich über diesen Zusammenhang nicht täuscht.
Erst dann kann man diese Prozesse vielleicht vorsichtig vergleichen mit den Utopien von solidarischer und kollektiver Produktion. Bei all diesen meist hastig und euphorisch ausgerufenen Begriffen wie ‘Crowd’ oder ‘Partizipation’ spielen ja alte emanzipatorische Hoffnungen der 50er und 60er Jahre eine Rolle und führen noch eine gespenstige Nachexistenz. Von der Interaktivität wurde bekanntlich geträumt lange bevor es interaktive elektronische Medien gab. Da war ja der Lexikon-Roman von Andreas Okopenko und die Hunderttausend Milliarden Gedichte von Raymond Queneau und all diese anderen Bücher, wo man sich die Texte selber zusammenstellen konnte…
MN: Mallarmé`s Le Livre und seine Faszination für die Zusammenarbeit mit anderen…
RP: Ja, genau. Und ich glaube, hilfreich wäre, Klarheit zu gewinnen und darüber nachzudenken, warum die Kunst etwa seit Beginn des 20. Jahrhunderts immer – oder oft – einen Anderen braucht in der Produktion. Das wäre in der Kunst des 19. Jahrhunderts keine Größe gewesen, soweit ich sehe. Da haben die Künstler aus sich geschaffen und waren damit zufrieden und haben sich auch großartig gefühlt, dass sie so viel schöpfen können. Im 20. Jahrhundert dagegen entsteht schon sehr früh (im Kubismus zum Beispiel, in der Arbeit mit den afrikanischen Skulpturen) so ein Reiz daran, irgendetwas zu finden, was man in die eigene Kunst einspeisen kann. Was aber auf einem Perspektivenwechsel gegenüber dem Hersteller beruht. Denn sie (die Kubisten) haben ja nicht gesagt: „Die Afrikaner sind großartige Künstler. Wir gehen jetzt in Pension und zeigen nur noch die!“ Sondern sie sagten: „Die machen irgendwie tolle Sachen, aber die wissen nicht, wie toll das ist und warum. Wir wissen das aber!“ Und da stellt sich sofort durch den Perspektivenwechsel das Gefälle in der Wertschöpfung her. Was die Afrikaner für die Skulpturen bekommen haben, war wahrscheinlich verschwindend im Vergleich zu den Kubisten, die das verarbeitet haben. Und dasselbe dann mit der Kunst von Verrückten, im Art Brut, und ebenso mit der Kunst von Kindern, und das geht ja bis in die jüngste Kunstgeschichte. Tobias Rehberger zum Beispiel hat in Afrika bei Möbelschnitzern einige klassische Bauhausmöbel in Auftrag gegeben. Und die haben das dann so ein bisschen frei variiert und der Stuhl, der normalerweise vier Beine hat, hat bei denen dann fünf. Aber es ist immer noch erkennbar als Bauhausmöbel. Jetzt weiss ich nicht, wie der Rehberger die bezahlt hat, aber das Prinzip scheint mir ähnlich zu sein wie Picassos Rezeption der afrikanischen Masken. Da hat man immer diesen Perspektivwechsel. Und dieses Strukturprinzip herrscht inzwischen in der Mode und in den Medien offenbar in ähnlicher Weise – als ästhetisches Prinzip. Nämlich dass uns nur noch das gefallen kann, was wir durch einen vermeintlichen Perspektivwechsel – oder durch einen wirklichen gewinnen. Das ist etwas anderes, als wenn wir sagen könnten: „Das ist schön! Das hast du hergestellt, und wir beide wissen, warum.“ Wir brauchen heute offenbar immer einen anderen, zu dem man sagen kann: „Das ist super, aber du weißt sicher nicht, warum! Ich aber weiß das.“ Dann finden wir das toll. Grob könnte man das auf zwei ästhetische Erfahrungsweisen zurückführen: Die Erfahrungsweise des Schönen braucht keinen unwissenden Anderen. Zum Beispiel die schöne Palastfassade, die kann man bewundern ohne denken zu müssen: „Der Architekt hat gar nicht gewusst, wie schön das ist. Ich aber weiß das.“ Hingegen die bedrohliche Gebirgsschlucht großartig zu finden, da muss man, wie Kant sagt, das Gemüt schon mit vielen Ideen angefüllt haben. Die Freude am Erhabenen ist darum immer auch eine Freude an der eigenen Ideenfülle. Und die unterscheidet einen selbst von anderen, die an dem selben Objekt darum nichts Erhabenes empfinden können. In der Erfahrung des Erhabenen wird darum immer gegen andere – beziehungsweise gegen die vorgestellte Empfindung anderer – Lust empfunden.
MN: Aber war das nicht immer schon der Fall? Ich meine, wenn ich an den Teppich von Bayeux zum Beispiel denke: Es gibt Momente, die als schön oder eben als überhaupt nicht schön empfunden wurden, aber eben auf irgendeine Weise die Künstler oder Auftraggeber berührten und deshalb dargestellt wurden?
RP: Das kann schon sein, dass auch da Schrecken oder etwas anderes verarbeitet wurde. Das bedeutet trotzdem nicht, dass nicht ein großer Unterschied darin besteht, wo die Syntheseleistung angesiedelt wird. Also am Teppich von Bayeux sterben Hunderte vielleicht an Pfeilwunden und trotzdem sagst du: „Was für ein schöner Teppich!“. Aber du traust dem Künstler selber zu, dass er gesagt hat: „Was für ein schöner Teppich!“. Oder: „Ich muss diesen Schrecken so verarbeiten, dass es einen schönen Teppich ergibt.“ Jedoch wenn wir Kunst von Afrikanern oder im Internet von irgendwelchen indischen Hotelportieren zusammensammeln, dann begehen wir einen Perspektivwechsel gegenüber denen. Die wissen meistens auch gar nicht, wofür wir das gebrauchen. Wir haben es zumindest sehr nötig, uns einzubilden, dass die nicht wirklich wissen, wofür wir das gebrauchen. Dass sie uns gegenüber sozusagen diese Syntheseleistung ermangeln, die wir erbringen. Denn wir haben das Gemüt schon mit allen Ideen angefüllt. Du weißt, wo du diese Schafe hinstellst, wenn Du Schafkünstlerin bist und wo du das ausstellst. Und du hast die Connections. Und du wirst auch berühmt damit natürlich. Nicht die. Und genauso hast du das Copyright an deinem Ready-made, und nicht derjenige, der das Pissoir oder das Bügeleisen entworfen hat.
Es gibt eine grundlegende Selbsttäuschung der Intellektuellen, wenn sie glauben, dass dies nur deshalb, weil es andere miteinbezieht, schon emanzipatorisch ist. Im Gegenteil, sie sollten sich die Ausbeutungspraktiken anschauen, dann wissen sie ungefähr, was sie da selber tun. Aber sie sollten sich auch noch etwas über ihr ästhetisches Empfinden überlegen und sich fragen, was sich da so stark verändert hat, dass wir fast keine Kicks mehr bekommen durch irgendetwas, das durch sich selber groß ist; sondern dass wir immer nur Kicks bekommen dadurch, dass wir irgendwen als unseren vorgeschobenen Idioten gebrauchen und dessen Leistung mit einem Perspektivwechsel zumindest aufzuladen glauben. Es könnte ja sein, dass die ja eh alle super smart sind, die da mitmachen, und dass das eigentlich alles Kunststudenten sind, die im Hotel als Portiere arbeiten. Aber wir haben es sehr nötig zu sagen: „Hoppla, da hat die Schafkünstlerin irgendwelchen anonymen Indern diese unglaublich vielfältigen Schafzeichnungen abgetrotzt.“
Und dem kommen natürlich noch Mechanismen der Förderungspolitik entgegen. Wenn du ein Projekt einreichst und zum Beispiel die Bewohner der dünner besiedelten Gebiete in Oberösterreich oder irgendeiner strukturschwächeren Region in irgendein Zeichenprojekt integrierst, bekommst wesentlich eher eine Förderung, als wenn du sagst, dass du ein geniales Bild malst.
MN: Ja, die Erfahrung habe ich damals bei der Leonart auch gemacht, als uns die Stadtgemeinde Leonding 2011 als künstlerische Leiterinnen bestätigte unter der Voraussetzung, dass wir Projekte unter Beteiligung der Bevölkerung initiieren. Da haben Dagmar Höss und ich dann zum partizipativen Ungehorsam aufgerufen. Bei meinem Projekt My Turked Ideas – und ich denke das trifft im Grunde auch auf Aaron Koblins The Sheep Market zu – war es jedoch etwas anderes, was mich interessierte. Ich wollte wissen, wer denn die Turker/innen zum Beispiel sind, wie kreativ sie sind und wie gehen sie mit einer Anfrage wie mit meiner überhaupt um. Also ein ehrliches Interesse an den Anderen, die zwar online anwesend aber eigentlich unsichtbar sind. Ich habe ihnen auch mitgeteilt, dass es sich um ein künstlerisches Forschungsprojekt handelt. Genau das war mir wichtig: wer macht mit, obwohl sie mich nicht kennen und er/sie weiss, dass es eine künstlerische Arbeit oder Forschungsprojekt werden könnte.
RP: Man könnte sich auch zur Sehnsucht nach dem unwissenden Anderen folgendes überlegen: Ich glaube, die Faszination kommt eher aus der Fremdheit, weil man sich da ja Kicks holt, von denen man glaubt, dass man sie innerhalb der Kunstszene nicht bekommen würde. Denn würde man denken, „Mir fällt zuwenig ein und ich bin sicher, wenn ich noch fünf Gleichgesinnte an Bord hätte, dann fällt uns wahnsinnig viel ein.“, dann würde man ja die Profis holen, die anderen von der Kunstuniversität Linz oder aus dem AEC oder wo immer man sich bewegt. Das macht man aber nicht, denn man holt sich bewusst Leute, die in dem Zusammenhang als Laien oder als Außenstehende erscheinen, und die Kicks, die das hat, kommen ja genau von dort her. Also von dem, was sie so ganz anders machen, als das die fünf Kollegen je hätten denken können.
Ich frage mich, ob sich da nicht auch in der Funktionsweise des Systems Kunst etwas geändert hat, weil ja Ausstellungen fast nur noch von Kollegen besucht werden und die Kunstszene ihr eigener Rezeptionsraum ist. Man kann ja kaum mehr eine Ausstellung machen, wo zur Vernissage nicht nur mehr Leute kommen, die eigentlich Konkurrenten sind. Es gibt ja kaum mehr sowas wie Sammler oder Liebhaber, so unschuldige Menschen, die das gerne sehen, aber überhaupt nicht selber machen. Die muss man heute ja mit der Lupe suchen bei einer Vernissage. Also die einen sind Kritiker, die anderen sind Kuratoren, die dritten sind intellektuelle Kommentatoren oder selber Künstler, aber sonst kommt doch keiner mehr. Und das hat eben was extrem Inzestuöses. Und bedingt vielleicht auch diese Notwendigkeit, dass dieses System ständig Neublutinfusionen braucht von außen. Wenn man das mit einem Kunstsystem des 19. Jahrhunderts vergleicht, haben die Künstler selber diese Rolle des Außen übernommen. Da gab es gebildete Kenner, die sich das gerne angeschaut haben, die da gestaunt haben und sich dann so eine Frage gestellt haben: „Was mag sich der Künstler dabei nur gedacht haben.“ Das mag sogar teilweise bis in die 60er oder 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts so gewesen sein. Aber das fragt heutzutage niemand mehr. Das weiss ja jeder heute ganz genau. Aber damals haben die noch so gerätselt und dann war eigentlich der Künstler der Afrikaner, nur stand er nicht am Platz der Ausbeutung. Er stand über dem Publikum und wurde bewundert. Diese Frischblutleistung kam vom Künstler. Heute dagegen spielt die Kunst selber das Publikum und holt sich das Blut von außen, aber bei schlechter Bezahlung.
MN: Ist es nicht auch ein entscheidender Unterschied, ob die Partizipation des Publikums an einem Kunstprojekt wissentlich oder unwissentlich stattfindet?
RP: Das ist richtig. Eine weitere wichtige Frage aber scheint mir zu sein, woran partizipiert wird: an der Herstellung? Oder am Nutzen des Produkts? Oder, mit Marx gesprochen: am Produktionsprozess, oder aber am Wertschöpfungsprozess? Ich kann ja zum Beispiel unwissentlich zu einem Mord beihelfen, indem ich jemanden irgendeine Substanz beschaffe, die der für ein Gift oder eine Bombe braucht, aber ich glaube, dass ich ihm das für etwas ganz anderes gebe. Dann habe ich unwissentlich am Herstellungsvorgang des Mordes teilgehabt. Ich kann aber auch unwissentlich am Wertschöpfungsvorgang des Mordes teilhaben, wenn ich Aktien der Firma besitze, die Blutdiamanten handelt. Und das weiss ich vielleicht auch nicht, weil ich nur in einen Fonds investiert habe, aber nicht ahne, wie der zusammengesetzt ist. Wissentliches und Unwissentliches kann somit auf beiden Ebenen eine Rolle spielen. Für die Frage aber, ob die Einbeziehung der Anderen etwas Emanzipatorisches hat oder nicht, scheint mir wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Genau wie in der Ökonomie heißt Einbezogensein in den Produktionsprozess auch in der Kunst meist nur Ausgebeutetwerden. Dagegen könnte Einbezogensein in den Wertschöpfungsprozess etwas Emanzipatorisches, Egalitäres sein. Als Einbezogene wären wir dann allerdings nicht so sehr ‘participants’, sondern wohl eher ‘shareholders’ an der Sache.
##
Und dann können sich natürlich noch solche Sachen ergeben wie – die würde ich jedoch nicht mehr Partizipation nennen, aber – die Phänomene der Interpassivität. Das wären wieder solche Rezeptionsgewinne, von denen die Künstler oder die Herstellenden nichts ahnen. Also wenn Slavoj Zizek sagt, dass er das super findet, wenn die SitCom im Fernsehen mit ihrem Dosengelächter über sich selber lacht, weil er dann nach einer wahnsinnig entspannt ist und das Gefühl hat, sich bestens amüsiert zu haben, auch wenn er überhaupt nicht zugehört und selbst gelacht hat, dann ist das ein Effekt, den die Produzenten nicht unbedingt vorhergesehen haben. Und Zizek delegiert seine Passivität an dieses Produkt und nutzt es dann in einer wohl nicht ganz beabsichtigten Weise. Das heißt, die anderen haben ihm, ohne es zu wissen, einen bestimmten Nutzen verschafft.
Wissen kann also auch auf der Rezipientenseite liegen, und Nichtwissen auf der der Produzenten. Wobei dann ist es schon fraglich, ob man das überhaupt noch Partizipation nennen kann. Ein Wort wie ‘Umnutzungen’ oder détournements würde diese Situation eher beschreiben.
MN: Es gibt bereits einen Ausdruck in der Kunst, wenn Produzenten, also Künstler unwissende Beteiligte haben oder sich die Produktionen anderer für die eigene Kunstproduktion aneignen: man spricht von Appropriations-Kunst / appropriation art.
RP: Ja, genau. Stimmt, das ist ein interessanter Kontext in der Frage. Denn die erkennen in gewisser Weise völlig an, dass der andere auch schon Künstler war. Elaine Sturtevant bei Andy Warhol oder Marina Abramovic in Bezug auf Valie Export.
MN: Ich beobachtete einige Netzprojekte, die Formen der Aneignung thematisieren. Im Besonderen denke ich zum Beispiel an die Arbeiten von Paolo Cirio. Die kritisieren eben genau diese Wertschöpfungsketten und der Künstler hinterfragt, wer welchen Nutzen von was hat. Themen wie Aneignung oder Auslagerung bekommen in der Kunst mit dem Internet eine neuerliche Relevanz, sowie aber auch Aktionismus in der Netzkunst eine erneute Relevanz bekommt.
RP: Ja, da sitzt Du an einer sehr guten Beobachtungsposition. Du musst dir eben nur darüber im Klaren sein, dass es hier sehr viel Akteurswissen und auch Akteursideologie gibt, die du nicht teilen darfst. Alle diese Dinge brauchen sehr viel Selbsttäuschung, um hergestellt zu werden und produzieren auch Begriffe, die dieser Selbsttäuschung dienlich sind, wie ‘Crowd’, ‘Crowdfunding’, ‘Kollektive Kunstproduktion’, ‘Verschwinden des Autors’ und so weiter. Das ist alles mit beträchtlichen Hoffnungen befrachtet. Wenn du nicht selber nur eine weitere Predigerin dieser Ideologie sein willst und die Selbsttäuschungen weiter systematisieren willst, musst du misstrauisch sein und dir immer die schlimmsten Möglichkeiten zu einem Begriff denken, damit du mit dem Selbstverständnis des Gegenstandes brechen kannst. Das ist die fundamentale Voraussetzung für eine Wissenschaft in Bezug auf so etwas. Louis Althusser hat mal geschrieben: „Die goldene Regel des Materialismus lautet: das Sein des Gegenstandes niemals mit seinem Selbstbewusstsein zu verwechseln.“ Also da gibt’s einen Gegenstand, der erzählt schon reiche Geschichten über sich selbst. Die musst du genau studieren, so, wie wenn er Leberzirrhose hätte. Du darfst aber nicht selber daran erkranken.
Concluding commentary
Mit dem Internet wurde ein Medium geschaffen, das per se partizipatorisch ist (vgl. O’Reilly 2005, welcher den Ausdruck Web 2.0 prägte; Er beschreibt das Softwaredesign der Webservices als “Architecture of Participation”). Und zusätzlich wurden mit dem Internet Formen der Beteiligung wieder evident, die zum Beispiel bereits von den Futuristen oder Dadaisten praktiziert wurden, aufgrund einer allgemein eher verklärten Einstellung zur Partizipation jedoch aus dem Blickfeld verschwanden: Im Besonderen geht es um unwissentliche und unfreiwillige Formen der Beteiligung und um den Stellenwert der Beteiligten im Werk. Was heißt hier jedoch Publikum? Was bedeuten hier „die Anderen“? Zwei wichtige theoretische Errungenschaften bilden die Basis dieser Überlegung: Dass Partizipation in der Kunst mehr ist als ein Community-Projekt, darüber schrieb bereits Christian Kravagna (vgl. Kravagna 1998). Dass künstlerische Partizipation nicht ausschließlich im Konsens mit dem Publikum passieren muss, darauf wies bereits Claire Bishop (2010) hin. Meine Erkenntnisse aus Gesprächen mit Künstler/innen bestätigen die Annahme von Robert Pfaller, dass Partizipation vor allem zugewiesene (Kunst-)Räume aufheben möchten, um in Kommunikation mit „den Anderen“ zu treten, für die das herkömmliche Verständnis und die Definition von „Publikum“ oder „Betrachter/in“ nicht mehr zutrifft. „Die Anderen“ sind in den digitalen Netzen unsichtbar, meistens kennt man sie nicht, und diese Fremdheit macht es aus, von der sich Künstler/innen angezogen fühlen, da diese im System Kunst kaum mehr anzutreffen ist. Dass dabei der Umfang der Beteiligung nicht als Maßstab fungieren kann, sondern dass Partizipation eine Methode vor allem zur Wissensgenerierung darstellt und es sich dabei nicht primär um eine ästhetische Diskussion handelt, davon spricht bereits Umberto Eco, als er sich 1962 mit dem offenen Kunstwerk und dem Kunstwerk in Bewegung beschäftigte. Beteiligung (wissentlich oder nicht wissentlich / freiwillig oder nicht freiwillig) basiert also auf Beobachtung, auf dem Generieren von Erfahrungen und Wissen durch „die Anderen“. In diesem Sinne kann es daher keine Wertung in der Art der Partizipation geben, und so wie es keine Als-ob Partizipation geben kann, kann es auch keine nicht funktionierende Partizipation geben, denn wenn Beteiligung stattfindet, dann impliziert dies immer ein Wissen, das generiert werden soll. Und Beteiligung der Beteiligung wegen macht wenig Sinn…